Blick durch die geöffnete Mauer. Der kranke Baum wurde auf eine Höhe von sechs Metern geschnitten. (Foto: © Martin Lauffer)
Der Schweizer Pavillon – eine Annäherung in drei Akten
Susanna Koeberle
Blick durch die geöffnete Mauer. Der kranke Baum wurde auf eine Höhe von sechs Metern geschnitten. (Foto: © Martin Lauffer)
Der Schweizer Pavillon soll sich an dieser Biennale selbst ausstellen und die architektonische Beziehung zu seinem unmittelbaren Nachbarn, dem venezolanische Pavillon von Carlo Scarpa (1906–1978), thematisieren. Der von Bruno Giacometti (1907–2012) entworfene Schweizer Pavillon wurde im Juni 1952 eröffnet. Der Bergeller Architekt und Bruder des bekannten Künstlers Alberto Giacometti reiste während der Bauzeit regelmässig nach Venedig und leitete vor Ort die Arbeiten. Dabei lernte er den venezianischen Architekten Carlo Scarpa kennen, der zur gleichen Zeit gerade den Eingangsbereich und das Ticketbüro der Biennale baute. Die beiden Baukünstler wurden Freunde. 1953 erhielt Scarpa den Auftrag, den Pavillon für Venezuela zu bauen, der allerdings erst 1956 fertiggestellt wurde. Interessant ist dabei, dass Scarpa sehr genau auf den Entwurf seines Schweizer Kollegen reagierte, obwohl sein Bauwerk einen ganz anderen Charakter besitzt. Das fast symbiotische Ineinandergreifen der beiden Grundrisse entstand auch aufgrund der schmalen Parzelle, die dem italienischen Architekten zur Verfügung stand. Die Mauern, Dächer und Aussenräume der beiden Bauten begegnen sich ganz unmittelbar – ein Unikum in den Giardini. Karin Sander und Philip Ursprung lesen die beiden Pavillons erstmals als bauliches Ensemble und reagieren darauf mit der Öffnung einer Mauer des Schweizer Pavillons.

Karin Sander im Gespräch mit Susanna Koeberle (Foto: © Flavia Rossi)
Hinterfragt Ihr Projekt durch die Geste der Öffnung und Grenzüberschreitung auch die Idee der nationalen Biennale-Pavillons? Auch Lesley Lokko betonte, sie verstehe Nationen sowie die nationalen Pavillons nicht als Territorien.
Karin Sander: Die Giardini in Venedig mit ihren nationalen Pavillons sind ein Ort, an dem das Konzept der nationalen Repräsentanz in den Pavillons immer wieder infrage gestellt wird und dadurch den Ort in seiner Eigenheit lebendig hält. Weit entfernte Länder werden hier zu zufälligen Nachbarn und so zum Bild einer globalisierten Welt. Uns interessieren die Entwürfe der beiden Architekten und die miteinander verbundenen Grundrisse, die wir wieder nachvollziehbar machen, indem wir eine Mauer des Schweizer Pavillons zu seinem Nachbarn hin öffnen und die Absperrgitter entfernen, was zudem immer wieder ein wichtiges Thema der Schweiz ist. Durch die Geste der Öffnung entsteht ein nonverbaler Dialog zwischen zwei benachbarten Pavillons, eine Zusammenarbeit mit dem Nachbarn gab es nicht. Trotzdem hat die Durchlässigkeit dieser offenen Mauer bereits viel in Bewegung gesetzt. Das Wegnehmen der Gitter und das Öffnen der Schweizer Mauer stellt zudem eine Mauer auf der venezolanischen Seite frei, die ursprünglich nicht zum Entwurf Scarpas gehörte und irgendwann wahrscheinlich als Provisorium hinzugefügt wurde.
Bereits der Schweizer Beitrag zur letzten Architekturbiennale drehte sich um die Grenze. Ist die Grenze ein typisches Schweizer Thema?
Philip Ursprung: Die Grenze ist sicherlich ein Thema, das in der Schweiz sehr virulent ist. Denken wir etwa an die Lockdown-Politik während der Pandemie, dann sehen wir: Das Schlimme kommt vermeintlich immer von aussen. Zuerst werden die Landesgrenzen geschlossen, dann der Gotthard, dann beachtet man argwöhnisch die Infektionsquoten der Nachbarkantone, der Nachbarquartiere, dann muss man in der Wohnung bleiben, schliesslich im Zimmer. Und es gibt noch das Thema Neutralität: Wie soll sich das Land verhalten im Bezug auf den Krieg in der Ukraine? Wie steht es mit der Europäischen Union? Wie steht es mit der Arbeitsmigration in den Grenzregionen Basel, Genf und Tessin? Diese Diskussionen sind stark emotional geprägt.

Blick auf den venezolanischen Pavillon von Carlo Scarpa (Foto: © Flavia Rossi)
Die Grenze ist nichts Statisches, sie ist wie eine Membran. Kann sie auch deswegen als Bedrohung wahrgenommen werden?
Philip Ursprung: Es kommt immer darauf an, auf welcher Seite der Grenze ich stehe. Wenn ich auf der Seite stehe, wo mir der nötige Ausweis fehlt, um reinzukommen, ist sie hermetisch dicht. Wenn ich einen in Europa gültigen Ausweis habe, kann ich nach Venedig reisen. Wenn nicht, dann komme ich nicht rein. Die Grenze ist nur für diejenigen nicht geschlossen, die darüber verfügen können. Eine Welt ohne Grenzen – das mag utopisch klingen. Aber die Utopie gehört zum Wesen von Ausstellungen. Genau diese Spannung interessierte uns.
Inwiefern ging es darum, das Thema Nachbarschaft auch auf einer ideellen Ebene abzuhandeln? Und gab es Bestrebungen, das auch auf venezianische Nachbarschaften auszudehnen?
Karin Sander: Wir arbeiten mit dem Ort und dem, was da ist. Indem wir die Mauer öffnen und die Gitter entfernen, machen wir aus dem Schweizer Pavillon einen neuen öffentlichen Raum, die Leute treffen sich jetzt im Schweizer Pavillon und nicht davor. Sie können sich auf die gemauerten Bänke setzen, die durch die gewonnenen Steine des Mauerabbruchs generiert wurden und anschliessend wieder für das Schliessen der Mauer eingesetzt werden. Auch eine Trinkwasserstelle lässt die Menschen im Pavillon verweilen.

Die Mauern der beiden Pavillons berühren einander beinahe. (Foto: © Martin Lauffer)
Mit dem Projekt «Neighbours» werden auch die Grenzen zwischen Disziplinen aufgebrochen: diejenigen zwischen Kunst und Architektur nämlich. Karin Sander sprach an der Pressekonferenz von einem Luftaustausch zwischen zwei getrennt gedachten Kammern. Dabei stellt sich die Frage, ob gerade die Sprache der Kunst besonders gut taugt für ein solches grenzkritisches Unterfangen. Der Begriff Lingua franca bezeichnet eine Sprache, die zu keinem Territorium und zu keiner Person gehört. Die romanisch basierte Pidgin-Sprache entstand im Mittelalter durch den Sprachkontakt zwischen Romanen und Sprecher*innen nichtromanischer Sprachen, insbesondere des Arabischen, und war als Handels- und Verkehrssprache bis ins 19. Jahrhundert vorwiegend an der Süd- und Ostküste des Mittelmeers verbreitet. Karin Sander und Philip Ursprung kommen aus der Welt der Kunst beziehungsweise der Kunstgeschichte und kuratieren dieses Jahr den Schweizer Pavillon an der Architekturbiennale.
Frau Sander, verstehen Sie Kunst als eine Art Lingua franca?
Karin Sander: Die Kunst hat einfach eine eigene Sprache sowie eine andere Herangehensweise als die Architektur und setzt damit auch andere Bilder frei. Philip Ursprung als Kunst- und Architekturhistoriker und ich als Künstlerin machen auf der Architekturbiennale eigentlich genau das: Wir zeigen die Architektur, die bereits da ist, aber so noch nie wahrgenommen wurde.
Als Besucherin ist man geneigt zu meinen, dass, wenn nichts gezeigt wird, man ja schon alles gesehen hat. Wie sind Sie damit umgegangen? Ist der Teppich oder die aus dem Mauerwerk gebaute Bank der Versuch, doch etwas Objekthaftes zu zeigen, den Pavillon also dennoch irgendwie zu füllen?
Karin Sander: Wir zeigen ja nicht nichts, sondern eigentlich sehr viel. Wir haben sechs verschiedene Eingriffe vorgenommen: Wir haben die Mauer geöffnet, mit den so gewonnenen Steinen Bänke gebaut und die Gitter entfernt. Wir haben Wasser zum Trinken installiert und nutzen den Grafikraum als Aufbewahrungsort für Printmaterialien. Wir haben die Pläne als Teppich herstellen lassen und ihn in den grossen Malereisaal gelegt, der genau die Verschränkung der beiden Pläne zeigt. Er funktioniert als eine Art Sockel für die sehr schönen originalen Zeichnungen der beiden Architekten. Die Besucher können auf dem Teppich laufen und die beiden Grundrisse nachvollziehen, sie in die Realität übertragen.
Geht es auch darum, Geschichten zu erzählen statt «nur» Objekte zu präsentieren – ganz im Sinne von Lesley Lokkos Ansatz?
Karin Sander: Ja, auch. Aber im Wesentlichen geht es uns um das Neuprogrammieren des Vorhandenen und daraus wiederum lassen sich dann weitere Erzählungen generieren, die beispielsweise auch auf die politische Dimension verweisen.

Begehbare Grundrisse im Schweizer Pavillon (Foto: © Flavia Rossi)
Der gelbe Leuchtstift wandert unruhig, aber freudig über die Seiten, dem Blick folgend oder sogar vorauseilend. Eine leidige Gewohnheit, Bücher mit Farbe zu verunstalten. Aber diese Geste kitzelt meine Synapsen, regt einen Austausch mit den Buchstaben und Gedanken an. Kann ein Schreibwerkzeug eigentlich auch verstehen? Wenn Pavillons reden können, vielleicht schon. In der den Schweizer Beitrag begleitenden Publikation führen Pavillon A (der venezolanische) und Pavillon B (jener der Schweiz) sieben Gespräche miteinander; sie sind zeitlich über fast 70 Jahre verteilt, das erste findet 1954, das letzte im Mai 2023 kurz vor der Eröffnung der 18. Architekturbiennale statt. Wobei die erste und letzte Szene – literarisch gesehen, handelt es sich nämlich bei diesem Text um ein Theaterstück – in diesem Jahr stattfinden, quasi die Ausflüge in die Vergangenheit umarmen. Sieben Gespräche, in denen wir einiges erfahren: Die beiden Nachbarn lernen sich kennen, fremdeln zunächst, werden zusehends vertrauter miteinander, erzählen von sich, sticheln zuweilen, tauschen ihre Meinungen und Ängste aus. Sie erscheinen als eigene Charaktere. Können Nachbarn Freude sein? Obschon sie eine Wand trennt? Doch die brennendere Frage an Philip Ursprung lautet:
Herr Ursprung, wieso geben Sie den Pavillons überhaupt Stimmen? Inwiefern war Ihnen das performative Element der Bauten wichtig?
Philip Ursprung: Wir hatten ja die Prämisse, dass wir von dem ausgehen wollen, was da ist: von der Beobachtung des Hier und Jetzt, der Materialien, der Oberflächen und der Korrelationen im Raum. Wir nehmen die Gegenstände im Pavillon sehr ernst und behandeln sie so, als ob sie Akteure wären. Auch die Materialien haben eine eigene Stimme. Das hängt im weitesten Sinne mit der Anthropozän-Diskussion zusammen, bei der auch das Nichtmenschliche als Akteur verstanden wird. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Als wir entschieden haben, dass der Pavillon sich selbst ausstellt, wurde er zu einem Subjekt. Wir haben zudem beschlossen, keine Wandtexte zu machen, die Resultate unserer Forschung also nicht auszustellen. Deshalb brauchten wir eine zusätzliche Ebene für den Diskurs. Wir nennen die Publikation bewusst Buch und nicht Katalog.
Wir hatten Kontakt mit der Kommissarin des venezolanischen Pavillons, aber ein eigentlicher Dialog mit den Nachbarn war nicht möglich. Deswegen kam die Idee auf, die Pavillons selbst miteinander sprechen zu lassen. Lieber ihnen eine Stimme verleihen, als über sie zu sprechen. Das Buch, an dessen Beginn unser Manifest steht, ist eine Ermunterung, Dialoge weiterzuspinnen. Ausserdem funktionieren beide Pavillons auch als Bühnen, szenografisch. Das Theatralische ist ihnen nicht fremd. Es erlaubte uns, viele Forschungsergebnisse in eine Story zu verpacken. Unser Buch soll auch unterhalten.
Es geht auch bei Lesley Lokko ausgeprägt um Narrationen. Ganz allgemein habe ich den Eindruck, dass die Zukunft von Architekturausstellungen in den letzten Jahren verstärkt ausgereizt wurde. Sehen Sie das auch so?
Philip Ursprung: Ich beobachte auch bei den Studierenden ein steigendes Interesse an Erzählungen. Und ich sehe auch, dass Architekturausstellungen zunehmend offen sind für Experimente in allen möglichen Medien. Die klassischen Formate weichen zunehmend anderen Narrativen. An dieser Transformation wollen wir mitwirken. Zugleich war uns bewusst, dass die Biennale ein Kontext ist, in dem Dutzende Pavillons miteinander konkurrieren und die Besucher*innen überladen werden mit Informationen. Deswegen entschieden wir: Es gibt in der Ausstellung nur einen ganz kurzen Text, das Manifest. Wir wollten unser Vorhaben mit wenigen Sätzen kommunizieren, so wie auch ein kurzer Blick in den Pavillon genügt, um sich ein Bild zu machen.
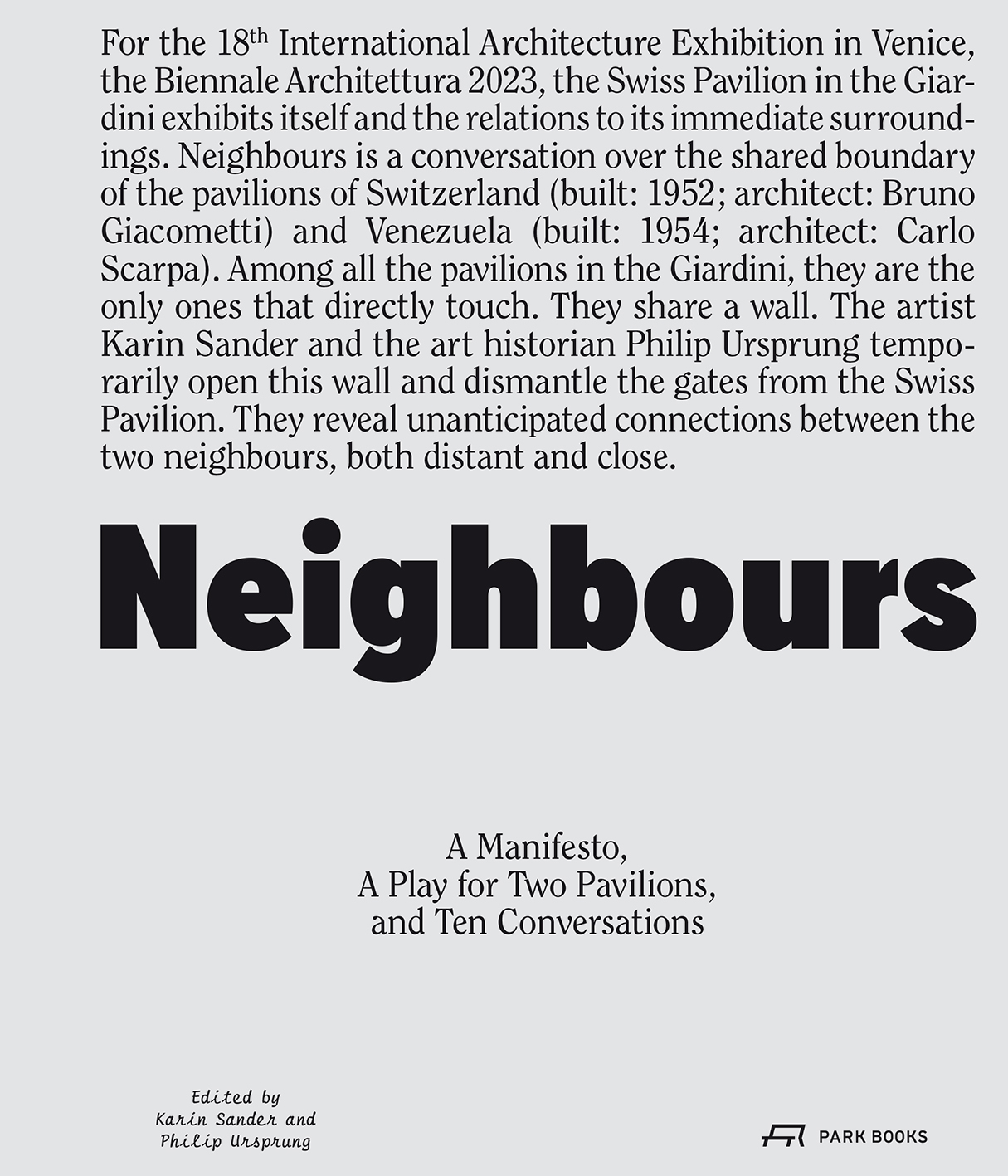
Neighbours
Karin Sander und Philip Ursprung (Hrsg.)
170 x 200 Millimeter
224 Pages
69 Illustrations
Broschiert
ISBN 978-3-03860-333-7
Park Books
Purchase this book
