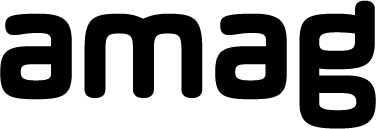Foto: Nadia Bendinelli, inedito
Christoph Brand: «Verglichen mit dem Ausland ist der Anteil neuer erneuerbarer Energien in der Schweiz noch viel zu gering»
Redaktion Swiss-Architects
Foto: Nadia Bendinelli, inedito
Konnten Sie bereits eigene Erfahrungen mit Elektroautos sammeln, Herr Brand?
Das kann man wohl sagen: Seit über acht Jahren fahre ich nun schon elektrisch. Meinen Wagen «tanke» ich mit Strom aus der Photovoltaikanlage meines Hauses.
Sie sehen ökologisches Potenzial in der Elektromobilität?
Mich überzeugen die Zahlen: Ein Elektroauto hat zunächst einen grösseren CO2-Rucksack als ein Verbrenner. Gerade die Produktion des Akkus ist im Hinblick auf den Umweltschutz und die Treibhausgasemissionen CO2-intensiver als jene eines Verbrennungsmotors. Doch wie Forschende des Fraunhofer Instituts ermittelt haben, ist die Umweltbilanz eines E-Fahrzeugs nach rund 50'000 Kilometern besser als die eines vergleichbaren Verbrenners. Lädt man mit Ökostrom, lässt sich diese Zahl auf nur 20'000 Kilometer senken.
Und noch etwas spricht für die Technologie: Elektromotoren setzen Energie effizienter in Vortrieb um als Verbrenner. Ihr Wirkungsgrad ist um Faktoren höher. Elektrofahrzeuge bringen also zwar einen Mehrbedarf an Strom mit sich, insgesamt aber sinkt die Menge an Energie, die wir für das Autofahren aufwenden müssen.
Interessant könnte auch sein, das Elektroauto als Speichermedium aufzufassen. Schliesslich sind Autobatterien um ein Vielfaches leistungsstärker als jene, die wir aktuell in Häusern verbauen.
Gerade die bidirektionale Speicherung, bei der das Auto geladen wird, aber auch Strom abgeben kann, bietet interessante Möglichkeiten. Technisch ist das eigentlich nicht allzu kompliziert, und entsprechende Fahrzeuge gibt es bereits. Zwar ist ihr Marktanteil leider noch verschwindend gering, er wächst aber immerhin. Man darf jedoch keine Wunderdinge erwarten: Die Bidirektionalität bleibt im ersten Schritt sicher noch auf das Ökosystem des einzelnen Hauses begrenzt. Bevor wir auf ein Netz von Autobatterien zugreifen können, liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.

Foto: Nadia Bendinelli, inedito
Sie sprachen es eben bereits an: Möchten wir zukünftig ohne fossile Energieträger auskommen, steigt unser Strombedarf – etwa durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb oder Wärmepumpen, die Ölheizungen ersetzen. Es ist selbstredend, dass dieser Mehrbedarf aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden sollte. Doch lässt sich in der Schweiz überhaupt noch wesentlich mehr Ökostrom produzieren?
Die kurze Antwort vorab: Ja. Aber beginnen wir bei der Wasserkraft: Sie bietet leider kein grosses Ausbaupotenzial mehr. Die guten Standorte sind längst belegt. Auch können nicht beliebig viele Staumauern erhöht werden, und Staumauern ergeben typischerweise keine grössere Strommenge, sondern sie sind Speicher. Das ist natürlich auch wichtig, aber wir brauchen vor allem einen Zuwachs bei der Menge. Man mag nun einwerfen, dass sich durch die Klimaerwärmung einige Gletschervorfelder auftun, die durchaus das Potenzial für neue Stauseen haben. Doch wir können dort keine Strommengen produzieren, die für die Dekarbonisierung wirklich ins Gewicht fallen.
In anderen Bereichen verfügen wir über ein ungleich grösseres Potenzial: Bei der Windkraft ist die Schweiz heute noch eine Nachzüglerin. Während Österreich über rund 1300 Windturbinen verfügt, haben wir gerade einmal 42. Von Dänemark und Deutschland reden wir besser erst gar nicht. Dabei wären hierzulande genügend gute Standorte vorhanden.
Grosse Möglichkeiten sehe ich auch bei der Photovoltaik. Hier müssen wir zwischen kleinen Anlagen, wie man sie etwa auf Hausdächern findet, und Grossanlagen unterscheiden. Gegen Dachanlagen gibt es zwar kaum Widerstand, doch dafür produzieren sie im Winter nur wenig Strom und sind teurer pro Megawattstunde als Grossanlagen. Um den einen Nachteil wettzumachen, könnten wir extrem viele Anlagen bauen, was jedoch sehr teuer wäre und das Netz stark belasten würde. Grossflächige Solarkraftwerke hingegen können deutlich mehr bewirken. Insbesondere Anlagen über dem Nebelmeer können gerade im Winter viel Strom produzieren, also dann, wenn er knapp ist. Um den im Zuge der Dekarbonisierung steigenden Strombedarf zu decken, darf man nicht nur auf Dachanlagen setzen, sondern muss auch Grossanlagen bauen.
Am Ende sollten wir auf allen Schienen fahren. Es hilft uns nicht, die eine Technologie gegen die anderen auszuspielen. Die Profile ergänzen sich: Ein Windrad zum Beispiel produziert zwei Drittel des Stroms im Winter, eine kleinteilige Solaranlage 75 Prozent im Sommer. Es mangelt uns in der Schweiz bei den erneuerbaren Energien nicht am Ausbaupotenzial – das Problem ist, dass es niemand erlauben will.
Sie formulieren das sehr zugespitzt. Warum? Stimmt es denn nicht, dass die Bevölkerung mehrheitlich den Ausbau erneuerbarer Energien begrüsst?
Unsere Planungs- und Bewilligungsprozesse dauern leider schier endlos. Wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft werden, vergehen teilweise Jahrzehnte, ehe man weiss, ob eine neue Anlage gebaut werden kann – und das erleben wir in der Praxis auch so. Bei einem Netzausbau verstrichen sage und schreibe 38 Jahre, bis eine neue Hochspannungsleitung in Betrieb genommen werden konnte. Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits haben wir ein hinsichtlich Planung und Bewilligung zweigeteiltes föderalistisches System in der Schweiz, bei dem man auf jeder Entscheidungsebene von neuem Einspruch einlegen kann. Andererseits kämpfen wir mit dem bekannten Nimby-Phänomen: Zwar hält die Mehrheit der Menschen zum Beispiel Windräder grundsätzlich für eine gute Sache, doch wenn es konkret wird, findet sich immer eine Minderheit, die das betreffende Projekt zu verhindern weiss – und hierbei reicht schlussendlich eine Person, die bereit ist, den gesamten Instanzenweg auszuschöpfen. Wollen wir vorankommen in der Schweiz, so braucht es Kompromisse von uns allen.

Foto: Nadia Bendinelli, inedito
Sie arbeiten nicht nur in der Schweiz am Ausbau der Produktionskapazitäten für grünen Strom, sondern bauen auch Kraftwerke im europäischen Ausland. Warum?
Dazu muss man zunächst verstehen, dass Energie ein ganz und gar internationales Thema ist. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen wir in der Schweiz mit etwas Wasserkraft grosse Teile unseres Strombedarfs decken konnten. Chinas Industriepolitik zum Beispiel beeinflusst heute unmittelbar den Strompreis hierzulande und letztlich auch die Versorgungssicherheit. Um den Herausforderungen unserer globalisierten Welt zu begegnen, ist es sinnvoll, sich international aufzustellen. Darum bauen wir Onshore-Windkraftwerke und grosse Photovoltaikanlagen in Europa.
Man muss bedenken: Die Schweiz ist das am besten ins europäische Stromnetz integrierte Land, und eine autarke Energieversorgung unseres Landes wäre unbezahlbar und überdies technisch kaum umsetzbar. Darum kann man sagen: Wenn Europa genug Strom hat, hat auch die Schweiz genug Strom. Denn dann können wir importieren, wenn wir es brauchen. Wenn wir also beispielsweise in Frankreich ein neues Windkraftwerk bauen, hilft das dem europäischen Netz und damit auch der Schweiz.
Sie erwähnen die Versorgungssicherheit. Wenn der Verkehr Zug um Zug auf Elektrofahrzeuge umgestellt wird, steigt ihre Bedeutung noch einmal immens. Was können wir tun, um sie sicherzustellen?
Die Antwort ist ganz einfach: Bauen, bauen, bauen. Wir müssen viel schneller CO2-freie Produktionsanlagen schaffen. Verglichen mit dem Ausland ist der Anteil neuer erneuerbarer Energien in der Schweiz noch viel zu gering.

Foto: Nadia Bendinelli, inedito
Wir haben bisher über den mit der Dekarbonisierung steigenden Strombedarf gesprochen und darüber, wie dieser gedeckt werden kann. Doch bedarf es auch eines Ausbaus der Netze, um den mehr produzierten Strom zu verteilen?
Ja. Und leider geht das oft vergessen – mit unschönen Folgen: Man hat zum Beispiel einen attraktiven Standort für eine neue Photovoltaikgrossanlage, doch muss Jahrzehnte auf den Netzanschluss warten.
Wie sehr die Netze um- und ausgebaut werden müssen, hängt indes davon ab, wie wir uns bei der Produktion künftig aufstellen. Gehen wir zum Beispiel einmal davon aus, wir würden den gesamten Strombedarf über kleinteilige Photovoltaikanlagen decken, die wir auf jedem Dach und an jeder Fassade installieren: Es würden kolossale Lastspitzen entstehen, weil überall zur selben Zeit besonders viel Strom produziert wird, den wir Stand heute nicht im grossen Massstab speichern können. Dafür sind unsere Netze nicht ausgelegt. Stattdessen ging man bei der Konzeption von wenigen, aber sehr grossen und zentralen Produktionsstellen aus. Kurzum, wir müssten in diesem hypothetischen Szenario die Netze zu immensen Kosten umbauen. Wenn man aber diversifiziert und verschiedene Technologien wie Wind- und Wasserkraft sowie Photovoltaik intelligent mischt und die Produktion möglichst über das ganze Jahr verteilt, kann das bestehende Netz effizient genutzt werden.
Wie wird die von Ihnen angesprochene Diversifizierung gesteuert?
Zu einem guten Teil ist die Entwicklung zum Glück dem Markt überlassen. Aber das Verhalten des Staates hat einen substanziellen Einfluss auf die Investitionen. Einerseits sind Vorschriften und Auflagen eine wichtige Stellgrösse, andererseits spielt die Förderung von bestimmten Technologien eine wesentliche Rolle.
Es wäre zu begrüssen, wenn sich die Unterstützung am volkswirtschaftlichen Nutzen orientieren würde, und zwar in einer Vollkostenberechnung. Konkret: Wenn man erkennt, dass eine zusätzliche Megawattstunde Photovoltaikstrom im Sommer volkswirtschaftlich keinen Wert hat, dann sollte sie auch nicht gefördert werden. Hingegen ist eine zusätzliche Megawattstunde Winterstrom wertvoll und müsste entsprechend mehr Förderung erhalten. Die Differenzierung der Fördermechanismen wird zwar zusehends besser, aber sie ist noch immer zu rudimentär. Und die Gesamtkosten inklusive des nötigen Netzausbaus werden heute zu wenig berücksichtigt.
Bringen Sie sich in den politischen Diskurs ein?
Unbedingt. Dabei möchten wir allerdings nicht wertend sein. Lieber zeigen wir technologieneutral auf, welche Möglichkeiten bestehen, um die Klimaziele zu erreichen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, und wie hoch die Kosten jeweils sind. Die Entscheidungen müssen dann andere treffen, dafür braucht es eine gesellschaftliche Diskussion. Die Menschen müssen sich zum Beispiel fragen, ob sie sich mit vielen neuen Windrädern arrangieren können oder doch auf die Kernkraft setzen wollen.

Foto: Nadia Bendinelli, inedito
Eine fruchtbare gesellschaftliche Debatte zu führen, ist allerdings schwierig. Viele Menschen scheinen heute sehr festgefahren in ihren Überzeugungen und nur noch begrenzt willens, alle Vor- und Nachteile nüchtern abzuwägen.
Wir versuchen mit allen zu reden – ich diskutiere auch mit dem Direktor der Stiftung Landschaftsschutz und führe den Austausch mit der Präsidentin von Pro Natura. Wir werden die Klimakrise nur gemeinsam meistern können. Es braucht gute Kompromisse und die Mitwirkung aller. Ich fände es schön, wenn wir künftig weniger auf die Meinungsunterschiede fokussieren, sondern auf die Punkte, in denen wir uns einig sind. Noch halten wir uns in der Schweiz mitunter zu sehr mit den Problemen auf, statt mit einem gesunden Pragmatismus auf die Möglichkeiten zu schauen, die sich uns bieten.
Diskutiert man inzwischen auch gerne mit Ihnen? Die Axpo genoss lange nicht den besten Ruf, doch heute scheint der Umweltschutz ein wesentlicher Teil Ihrer Firmenphilosophie zu sein.
Es stimmt, wir waren in gewissen Kreisen nicht immer der willkommenste Gesprächspartner. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass unsere Aussenwahrnehmung lange verzerrt war. Eigentlich haben wir schon seit geraumer Zeit eine gute CO2-Bilanz in der Produktion, doch dass dies auch durch die Nutzung der umstrittenen Kernenergie zustande kam, trübte das Bild in den Augen vieler. Trotzdem stimmt Ihre Beobachtung: Wir richten unsere Aufmerksamkeit heute verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit. Aber, das möchte ich schon betonen, auf dem Fundament markwirtschaftlicher Prinzipien, auf der Basis einer marktwirtschaftlichen Überzeugung und mit dem Blick auf die Versorgung mit dem kritischen Gut Strom. Unsere Haltung ist klar: Wirtschaftswachstum ist etwas Gutes und lässt sich erreichen, ohne den Planeten zu ruinieren. Wir unterscheiden bei all unseren Aktivitäten zwischen einer gesellschaftlichen und einer betriebswirtschaftlichen Optik. Es ist unser Anspruch, nichts zu tun, was gesellschaftlich schlecht ist – auch wenn es uns rein ökonomisch nutzen würde.
Christoph Brand ist seit dem 1. Mai 2020 CEO der Axpo Gruppe und verfügt über einen Abschluss in Wirtschaft der Universität Bern. Zudem absolvierte er das Advanced Management Programm am INSEAD. Von 2012 bis 2020 war er in verschiedenen Funktionen bei der TX Group (vormals Tamedia) tätig, zuletzt als CEO von TX Markets, zu der unter anderem die Unternehmen Ricardo, Tutti, Jobs und Homegate gehören. Zuvor arbeitete er als CEO des Softwarehauses Adcubum, als CEO des Telekommunikationsunternehmens Sunrise, als CEO bei Bluewin sowie in führenden Positionen bei Swisscom, zuletzt als Chief Strategy Officer und Mitglied der Konzernleitung. Christoph Brand ist Mitglied des Verwaltungsrats AMAG Gruppe und Präsident des Verwaltungsrats CKW AG.